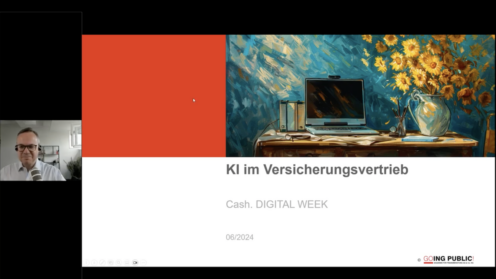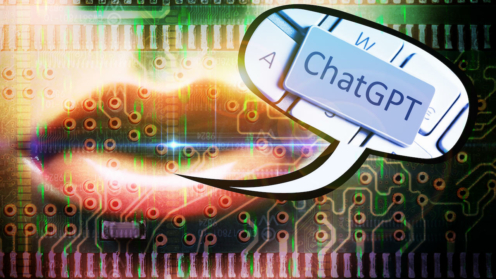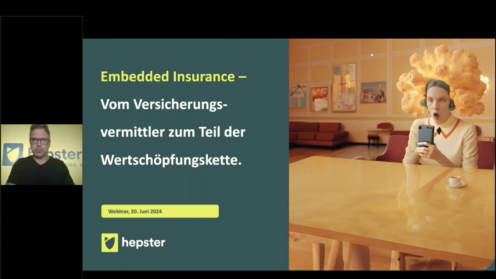Die Zielgruppe der Finfluencer ist in der Regel jung und unerfahren. Ist das nicht ein wichtiger Grund, die Bemühungen um eine bessere Finanzbildung zu verstärken?
Nadolny: Das ist aus meiner Sicht der deutlich wichtigere Punkt, und dafür appelliere ich, seitdem ich meinen Blog „Book of Finance“ vor nunmehr knapp fünf Jahren gegründet habe. Ein solides Fundament an finanzieller Bildung ist der sicherste Schutz davor, über den Leisten gezogen zu werden. Und dabei geht das Risiko ausdrücklich nicht nur von den Finanzbloggern aus. Auch die sollte man nun in der Diskussion nicht zum alleinigen Sündenbock machen. Ein Blick quer durch die Finanzbranche reicht aus, um zu erkennen, dass an allen Ecken und Enden der moralische Abgrund wartet, Notsituationen, Angst und Unwissenheit ausgenutzt werden. Deswegen führt aus meiner Sicht kein Weg daran vorbei, unsere Gesellschaft auf breiter Flur mit dem nötigen Wissen zu versorgen. Quellen dafür gibt es genug, nur fehlt vielen schlichtweg die Motivation dazu. Wer liest denn schon gerne Bücher außer ein paar Zehntausenden in meiner kleinen Bubble? Wer informiert sich wirklich breit und unabhängig, bevor er Verträge unterzeichnet? Und wer hinterfragt die Motivation eines „Experten“, Autors, Maklers oder Beraters? Das machen wohl nur die wenigsten unter uns, was garantiert auch ein Stück weit daran liegt, dass insbesondere die Finanzbranche es liebt, die Sachverhalte besonders komplex und abschreckend wirken zu lassen. Denn das hält mehr und mehr Leute davon ab, sich überhaupt damit zu beschäftigen.
Wen sehen Sie besonders in der Verantwortung?
Nadolny: Allen voran würde unserer Bundesregierung etwas mehr finanzielle Bildung sicherlich nicht schaden. Ich denke da nur an die unglaublich peinlichen Finanztipps unseres amtierenden Bundeskanzlers und ehemaligen Finanzministers, der sein Geld am liebsten auf dem Sparbuch angelegt hat. Auch in den Diskussionen rund um eine Finanztransaktionssteuer haben etliche Politiker ihr finanzwirtschaftliches Unwissen demonstriert. Und wenn selbst unser Wirtschaftsminister einen simplen Begriff wie „Insolvenz“ nicht zu begreifen vermag, dann sehe ich da ehrlich gesagt schwarz. Die finanzwirtschaftliche Politik der letzten Jahrzehnte spricht aus neutraler Perspektive Bände. Unser Staat tritt zumindest seine Vorbildfunktion mit Füßen. Gewissenhaft zu haushalten ist schon lange keine Option mehr, wo doch mit Wahlversprechen auf Kosten der künftigen Generationen so gut Stimmen gesammelt werden können. Und auch das „Schwarzbuch des Steuerzahlers“ ist jedes Jahr aufs Neue ein Armutszeugnis.
Die Schulen – zumindest die Schulformen neben dem Gymnasium – sind meist schon mit der Vermittlung von elementarem Grundwissen völlig ausgelastet. Die erfolgreiche Vermittlung von Finanzbildung erscheint dort aufgrund der Heterogenität der Schülerschaft schwierig. Was erwarten Sie von den Schulen?
Nadolny: In unserem Schulsystem mangelt es an allen Ecken und Enden. Wenn ich an meine Schulzeit zurückblicke und diese mit meinem selbstständigeren und zielorientierteren Lernen im Studium oder meiner Erwachsenenbildung nun vergleiche, dann könnte man schon einen breiten Blumenstrauß an Verbesserungen einbringen. Aber auch hier muss man sich nur die irrwitzigen bürokratischen Welten anschauen, die unser Bildungssystem in Ketten halten. Weltbewegende Reformen dürfen wir hier sicherlich nicht erwarten – mal ganz unabhängig davon, dass ich keinem einzigen meiner Lehrer von damals zutrauen würde, ein Fach wie Finanzen unterrichten zu können. Am Ende bleibt uns wohl oder übel nichts anderes übrig, als die Lücke in der Zwischenzeit irgendwie anders zu füllen. Und da können Finfluencer ein probates Mittel sein – sofern sie ehrlich und aufrichtig aufklären und eben keine Schrottimmobilien, Rohrkrepierer-Fonds und Heilig-Gral-Aktienanalyse-Strategien verkaufen.
Sie selbst haben sich gerade auf Weltreise begeben und arbeiten von unterwegs. Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen?
Nadolny: Ich möchte schlichtweg mehr von der Welt entdecken, Land und Leute kennenlernen, aus meiner Komfortzone herauskommen und über den Tellerrand blicken. Die Welt ist viel zu groß, zu vielfältig, zu aufregend und lehrreich, um sie nur aus deutscher Perspektive heraus zu betrachten. Zurzeit habe ich das Glück, weitestgehend ungebunden zu sein. Ich kann von überall auf der Welt arbeiten, habe noch keinen Nachwuchs, kein Eigentum, keine sonstigen Verpflichtungen. Da wollte ich dieses Zeitfenster nochmal vollends auskosten, bevor es möglicherweise in wenigen Jahren anders aussehen mag.
Auch hierzulande müssen viele Beschäftigte nicht mehr ins Büro. In 82 Prozent der Firmen der Informationswirtschaft arbeiten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mindestens einmal wöchentlich zu Hause, wie aus einer Umfrage des Wirtschaftsforschungsinstituts ZEW hervorgeht. Ist dieser Trend aus Ihrer Sicht unumkehrbar?
Nadolny: Man kennt solche Entwicklungen bereits aus der Vergangenheit. Arbeitnehmer werden Vorteile, die sie erst einmal lieben gelernt haben, sicherlich nicht mehr so schnell abgeben wollen. Insbesondere in einem Arbeitsmarkt, auf dem sich gut ausgebildete Fachkräfte fast schon den Arbeitgeber aussuchen können, sehe ich kein Ende dieses Trends. In vielen Fällen – und das darf man nicht außer Acht lassen – macht es auch schlichtweg Sinn. Nur wenn das Homeoffice lediglich als Anreiz und nicht mit Sinnhaftigkeit und Überzeugung etabliert wurde, sehe ich es kritisch. Auch in meinen Unternehmen habe ich leider immer wieder miterleben müssen, dass solche Freiheiten sehr gerne mal ausgenutzt werden. Wenn der Chef nicht da ist, tanzen die Mitarbeiter auf den Tischen – so oder so ähnlich.
Die Fragen stellte Kim Brodtmann, Cash.