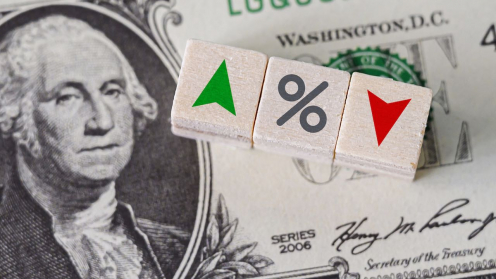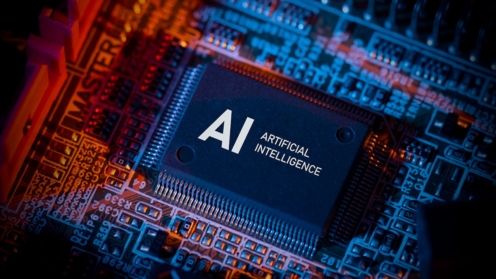Die Europäische Zentralbank (EZB) und die europäischen Regierungen unterstützen die Unternehmen mit viel Geld. Trotz der Geldschwemme ist aber nicht mit einem Anstieg der Inflation zu rechnen – wahrscheinlicher ist vielmehr eine Deflation. Ein Beitrag von Dr. Markus Demary, Senior Economist für Geldpolitik und Finanzmarktökonomik beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW).
Die Corona-Krise hat in vielen Industrien die Produktion gestoppt. Viele Menschen sorgen sich daher, dass die Preise steigen. Zusätzlich beflügelt werden die Inflationssorgen durch eine nie gekannte Geldschwemme. Um den Unternehmen in der Krise zu helfen, haben viele europäische Länder umfangreiche Hilfsprogramme gestartet. Allein Deutschland stellt insgesamt 750 Milliarden Euro bereit. Zusätzlich hat die Europäische Zentralbank ihre Anleihenkäufe ausgeweitet. Dennoch stehen die Zeichen jetzt eher auf Deflation als auf Inflation – und zwar aus drei Gründen.
Nachfrage der Unternehmen und Haushalte ist niedrig
Erstens: Den Unternehmen sind die Umsätze eingebrochen, es drohen hohe Verluste. Manager sind froh, wenn sie mit den Hilfsgeldern jetzt Gehälter, Zinsen und bestellte Waren zahlen können – an Investitionen ist kaum zu denken. Da die Unternehmen die Hilfskredite zurückzahlen müssen, werden sie Investitionen auch in naher Zukunft eher aufschieben und stattdessen Schulden abbauen. Durch die Zurückhaltung bei den Investitionen fehlt dann Nachfrage, wodurch die Preise stagnieren.
Zweitens: Die Nachfrage der Haushalte trägt ebenso wenig zur Inflation bei. Zwar werden die Konsumenten bald einige Ausgaben, zum Beispiel für den Friseur, nachholen, dann jedoch ihr Kaufverhalten in gewohntem Muster fortführen. Restaurants, Konzerte oder Fußballspiele können sie nicht nachträglich besuchen; zudem werden Veranstaltungen dieser Art wahrscheinlich ohnehin eine Zeit lang gar nicht möglich sein. Zudem haben die Hamsterkäufe am Anfang der Corona-Krise die Vorratskammern gefüllt, die entsprechenden Produkte werden jetzt kaum nachgefragt. Außerdem ist davon auszugehen, dass die Haushalte aus Unsicherheit über den weiteren Verlauf der Krise jetzt mehr Geld sparen, wodurch ebenfalls die Nachfrage sinkt – und damit kaum Inflationsdruck entsteht.
Fallender Ölpreis trägt zur Deflation bei
Drittens: Die Inflationsrate wird zu einem großen Teil durch die Veränderung des Ölpreises erklärt – sinkt der Ölpreis, fällt in der Regel auch das Preisniveau. Derzeit ist der Ölpreis sehr niedrig. Dazu hat auch die geringe Benzin- und Kerosinnachfrage aufgrund unterlassener Reisen beigetragen. Was den Zusammenhang zwischen Ölpreis und Inflation angeht, sind verschiedene Szenarien denkbar: Inflationsdruck könnte in Zukunft über den Benzinpreis entstehen: Menschen, die früher eher mit Bus und Bahn unterwegs waren, fahren in Zeiten von Infektionsrisiken mehr mit ihren eigenen Autos. Es ist aber auch möglich, dass dienstliche Reisen ausbleiben, da Video-Konferenzen und digitales Arbeiten stark an Akzeptanz gewonnen haben.
Insgesamt ist ein Anstieg der Inflation nicht wahrscheinlich. Vielmehr könnte Corona uns in eine Deflation führen. Fallende Preise wirken auf Verbraucher erst einmal attraktiv, aber für die Wirtschaft sind sie gefährlich: Wenn Unternehmen und Konsumenten erwarten, dass Waren und Dienstleistungen immer günstiger werden, schieben sie viele Ausgaben auf. So kann sich die Deflation schnell verfestigen und die wirtschaftliche Entwicklung bremsen.