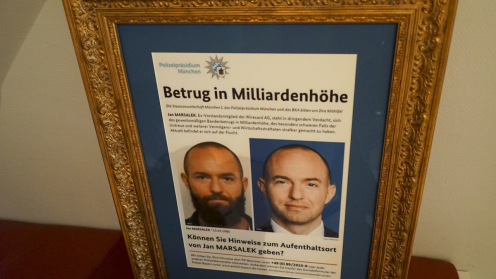Nach den USA hat auch die Europäische Union (EU) im Juni höhere Zölle auf Importe von Elektrofahrzeugen angekündigt. Zu den bestehenden zehn Prozent kommen in Zukunft noch individuelle Aufschläge on top. Die Maßnahme zielt in erster Linie auf chinesische Importe, betrifft aber auch westliche Unternehmen. So soll etwa der Hersteller BYD 17,4 Prozent, Geely 20 Prozent, MG/SAIC rund 38 Prozent und andere (westliche) Exporteure mit Aufschlägen von 21 Prozent beziehungsweise 38,1 Prozent belegt werden. Die von der EU verhängten Zollmaßnahmen betreffen insgesamt ein Importvolumen von 9,7 Milliarden Euro (Stand 2023).
Mit dem Hochziehen der Zollschranken will die EU die hiesige Automobilindustrie vor billigen chinesischen Importen schützen. Doch tatsächlich halten sich die gesamtwirtschaftlichen Effekte der europäischen Zölle auf E-Fahrzeuge in Grenzen. Gemessen an den gesamten chinesischen Einfuhren in die EU machen E-Autos nur 1,9 Prozent der Einfuhren aus.
Für einen überwiegenden Teil der chinesischen Fahrzeugbauer dürfte es weiterhin attraktiv bleiben, ihre Fahrzeuge in den europäischen Markt einzuführen, da sie ihre ausreichend hohe Marge als Puffer nutzen können. Stärker von den Zöllen getroffen werden hingegen Exporte von E-Autos westlicher Automobilhersteller, die ihre in China gefertigten E-Fahrzeuge in den europäischen Markt importieren: So wird etwa Tesla aktuell mit 21 Prozent Zöllen belegt.
Chinas Reaktion
China wird auf die Zollankündigung reagieren und dabei zwei Wege einschlagen: Zum einen dürfte die Volksrepublik die Handelsbarrieren für den Import europäischer Güter erhöhen. Das könnte vor allem Sektoren treffen, die den chinesischen Markt in erster Linie über den Außenhandel bedienen und wenig bis keine eigenen Produktionsstätten in China haben, um nicht der eigenen Wirtschaft zu schaden. Potenzielle Ziele könnten europäische Luxusgüter, landwirtschaftliche Güter oder auch teure Autos mit großen Verbrennungsmotoren sein.
Zum anderen dürfte China das Engagement in Europa ausweiten und hier mehr produzieren, um so die höheren Zölle zu umgehen. Chinesische Autobauer haben bereits angekündigt, künftig auch in Ungarn und Spanien Autos fertigen zu wollen. Das wirft die unmittelbare Frage auf, wie Europa darauf reagieren soll. Unstimmigkeiten zwischen den Mitgliedsländern sind vorprogrammiert.
Und dann gibt es noch den dritten Player: die USA. Diese haben Mitte Mai neue Zölle gegen China erhoben, unter anderem auf Elektroautos, Halbleiter und Solarpaneele. Allerdings sind die Auswirkungen der Zollankündigungen auf beiden Seiten überschaubar. Das Handelsvolumen der betroffenen Güter ist mit 18 Milliarden US-Dollar zwar relativ gering, dafür wurde aber der Zoll für chinesische E-Fahrzeuge auf 100 Prozent hochgeschraubt, um die chinesische Dominanz im amerikanischen Markt für E-Autos zurückzudrängen.
Dagegen scheinen die europäischen Zollerhöhungen moderat, was sich aus der tiefgreifenderen wirtschaftlichen Verflechtung erklärt. Einerseits ist der europäische Marktfür wichtige chinesische Industriegüter von größerer Bedeutung als die USA. Je nach importiertem Gut können europäische Zölle die chinesische Wirtschaft also stärker treffen als Erhöhungen aus den USA. Andererseits sind auch europäische Unternehmen vom chinesischen Absatzmarkt abhängig. Entsprechend groß ist das „Vergeltungspotenzial“ Chinas gegenüber der EU.
Europa als Verlierer
Diese Wechselbeziehung macht deutlich: Europa tut sich schwer im Großmachtwettbewerb zwischen den USA und China. Es ist nicht nur hin und her gerissen zwischen dem transatlantischen Bündnis einerseits und der tiefen wirtschaftlichen Verflechtung mit China andererseits. Vielmehr kommen auch interne Unstimmigkeiten hinzu, wie mit China künftig umgegangen werden soll. Bei einem Zollwettlauf steht daher Europa auf der Verliererseite.
Autor Marco Weber arbeitet seit 2018 als Volkswirt im Portfoliomanagement von Union Investment. Neben der volkswirtschaftlichen Analyse des asiatischen Raums beschäftigt er sich vor allem mit geoökonomischen Fragestellungen.