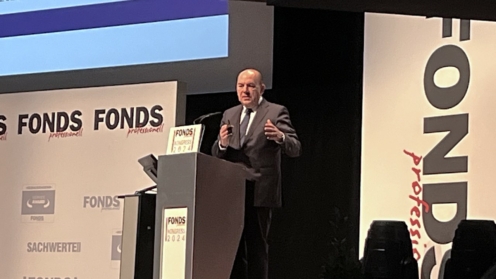Von nun an wird ad hoc nach Datenlage entschieden, die, so sieht es aus, nicht mehr zwingend eine noch schärfere Restriktionspolitik erfordert. Nicht nur das, auf einmal ist auch wieder das Gespenst einer Bankenkrise aufgetaucht und mit ihr das Risiko, dass sich die aktuelle wirtschaftliche Stagnation des Euroraums in eine veritable Rezession verwandelt.
Genug ist genug. Seit dem Sommer 2022 hat die europäische Notenbank den Hauptrefinanzierungssatz für Banken von 0 Prozent auf jetzt 3,5 Prozent angehoben, also um 350 Basispunkte. Getrieben von einer Explosion der Preise für importierte Energie war die allgemeine Inflation drauf und dran, aus dem Ruder zu laufen, so dass entschlossenes Gegensteuern alternativlos zu sein schien. Im historischen Kontext ist das Zinsniveau zwar immer noch niedrig, aber selten wurden die Zügel so schnell und so stark angezogen wie diesmal, nachdem mehr als 13 Jahre lang im Kampf gegen die Deflation eine extrem lockere Politik betrieben wurde. Das alles gilt im Übrigen fast eins zu eins auch für die USA.

Bisher entsprechen die Folgen des Kurswechsels dem, was mit den höheren Zinsen erreicht werden sollte: die Nachfrage zu dämpfen und dadurch die Spielräume für höhere Preise, Mieten und Löhne zu verringern. Bei den europäischen Verbraucherpreisen hat es bisher noch nicht so richtig geklappt – sie lagen zuletzt um 8,5 Prozent über ihrem Vorjahresniveau, und selbst die Kernrate beträgt nicht-akzeptable 5,5 Prozent. Das 2 Prozent-Ziel der EZB ist daher noch in weiter Ferne.
Aber auf den vorgelagerten Stufen tut sich eine Menge. Die Weltmarktpreise für Öl sind in den vergangenen zwölf Monaten um etwa 30 Prozent gesunken, die frei gehandelten Gaspreise sogar um 70 Prozent, die deutschen Einfuhrpreise in den vergangenen sechs Monaten mit einer annualisierten Rate von 10,2 Prozent, die gewerblichen Erzeugerpreise sogar mit einer von 14,5 Prozent. Gesunken! Und die Löhne, die wichtigste Kostenkomponente? Sie waren im vierten Quartal in Deutschland real deutlich niedriger als ein Jahr zuvor und reduzieren damit die Konsumnachfrage und das Wirtschaftswachstum insgesamt, während die nominalen Bruttolöhne und -gehälter auf Stundenbasis trotz der starken Geldentwertung und des robusten Arbeitsmarkts mit einer annualisierten Rate von nur 4,9 Prozent zugenommen haben (4. Quartal 2022).
Ich vermute, dass die Inflationsraten auch auf der Verbraucherstufe von nun an rasch zurückgehen werden. Gerade hat die OECD ihre Prognose für den Euroraum gegenüber dem vergangenen November für dieses Jahr von 6,8 auf 6,2 Prozent reduziert (und auf 3,0 Prozent für das Jahr 2024). Ebenso der EZB-Stab: Für das laufende Jahr wird nur noch mit 5,3 Prozent gerechnet, im Dezember waren es noch 6,3 Prozent, und im kommenden Jahr soll die Inflationsrate dann auf 2,9 Prozent fallen. Insgesamt bedarf es keiner weiteren Schützenhilfe der EZB. Sie kann abwarten.
Wie eingangs erwähnt, erweist sich der Bankensektor einmal mehr als ein großer Risikofaktor. Das betrifft zwar bisher fast ausschließlich die USA und die Schweiz, die bis vor wenigen Tagen noch als die sicheren Häfen für Bankeinlagen schlechthin galten. Da aber die Finanzmärkte international eng miteinander verzahnt sind, würden größere Bankpleiten dort unmittelbar auch den Bankensektor des Euroraums in Mitleidenschaft ziehen. Es wäre gefährlich, durch noch höhere Leitzinsen Öl ins Feuer zu gießen.

Der plötzliche Übergang von einer langjährig ultralockeren zu einer „normalen“, wenn nicht sogar restriktiven Geldpolitik hat vor allem die Geschäftsmodelle mittelgroßer – und nur lax beaufsichtigter – amerikanischer Banken zunichte gemacht. Lange Zeit war es für sie sehr lohnend, auf der Basis von niedrig verzinsten Kundeneinlagen und Geldmarktverbindlich-keiten besser verzinste Aktiva mit längeren Laufzeiten zu erwerben, das Ganze auf einer schmalen Eigenkapitalbasis. Der Anreiz, die Fristenstruktur der beiden Bilanzseiten einander anzugleichen, vor allem durch die Emission länger laufender (vergleichsweise teurer) Bankanleihen mit festen Zinsen, bestand lange nicht. Auch die Aufsichtsbehörden schritten nicht ein, oder jedenfalls nicht energisch genug. Realistische Stresstests, die nicht zuletzt unter der Annahme einer plötzlichen Inversion der Zinsstruktur durchgeführt wurden, gab es wohl nicht.
Nachdem die Kosten der Refinanzierung durch die höheren Leitzinsen seit einigen Monaten stark in die Höhe gegangen waren und gleichzeitig der Marktwert der Aktiva in dem Maße sank, wie das allgemeine Zinsniveau stieg, kam es plötzlich zu großen (anfangs allerdings noch nicht realisierten) Verlusten, die wiederum die Besitzer von Kundengeldern verschreckten. Nur Beträge bis 250.000 US-Dollar waren durch die nationale Einlagensicherung gedeckt. Zunehmend wurden Gelder von den kleineren Banken abgezogen und bei Großbanken angelegt, die nach wie vor wegen ihrer systemischen Bedeutung als sicher gelten.
Das Risiko eines Flächenbrandes war in den USA so groß, dass die zuständigen Behörden in ihrer Panik gleich mindestens zwei ordnungspolitische Sünden begingen, die sich noch rächen können: Auch Einlagen jenseits der Grenze von 250.000 US-Dollar wurden quasi über Nacht in vollem Umfang garantiert, also auch bei Banken, die de facto bankrott sind. Zum Zweiten können sich die gefährdeten Banken nunmehr für einige Zeit von der Fed gegen ihre Aktiva Geld leihen, und zwar auf der Basis ihrer (hohen) Nennwerte und nicht der deutlich niedrigeren Marktwerte.
Wir lernen einmal mehr, dass es für den Bankensektor und die Konjunktur gefährlich wird, wenn Notenbanken von expansiv auf restriktiv umschalten. In den vergangenen Jahrzehnten folgten Bankenkrisen, Rezessionen oder längere Stagnationsphasen fast immer auf einen geldpolitischen Kurswechsel. Dass sich etwas zusammenbraute, ließ sich meist an einem Anstieg der Probleme im Immobiliensektor ablesen. Insgesamt müssen die Banken strikter beaufsichtigt werden. Und: Sie haben kein natürliches Anrecht auf exorbitante Gewinne.
Dieter Wermuth ist Economist und Partner Wermuth Asset Management.